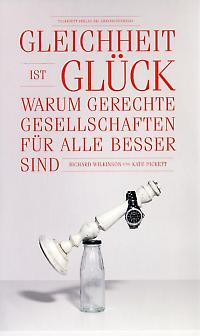Kriminelle Netze
Über den Wandel der italienischen Mafia berichtet der Deutschlandfunk. Ursprünglich war die aus dem süditalienischen Kalabrien stammende Ndrangheta auf Entführungen spezialisiert. Mit dem Wechsel in den Drogenhandel haben die Clans die Kontrolle über die Region übernommen – dort arbeitet nach Schätzungen der Ermittler ungefähr ein Viertel der Bevölkerung für Mafiaorganisationen. Gegen die internationalen Netze haben die Behörden bis jetzt kein Mittel gefunden; auch in Deutschland operieren etwa 230 Clans. »Hier haben wir es dagegen mit ländlich geprägten Dörfern zu tun, die dabei sind, Regionen und Nationen zu erobern«, so der Politiker und Soziologe Nando Dalla Chiesa. Neben Drogengeschäften wird die Ndrangheta verdächtigt, Schiffe mit Atommüll vor der Küste versenkt zu haben. Wer offen gegen die Mafia auftritt, wie der Schauspieler Giulio Cavalli gegen die sizilianische, dessen Leben ist bedroht.
Verhandeln im Verborgenen
Florent Latrive verdeutlicht in der Le Monde diplomatique, wie internationale Abkommen die Demokratie aushebeln können. Denn in den Vehandlungen um das Anti-Counterfeiting Trade Agreement – kurz Acta – sitzen Medienkonzerne am Verhandlungstisch, während Mitglieder des Europaparlaments keinen Einblick in den Stand der Verhandlungen bekommen. Ein Verhandlungsführer der europäischen Kommission bezeichnet dies jedoch als gängige Praxis. In dem Handelsabkommen geht es um Maßnahmen gegen Produktpiraterie. Diese umfasst sowohl illegale Downloads von Musik, als auch so genannte Generika – billige Kopien patentierter Medikamente, die beispielsweise in Afrika zur AIDS-Bekämpfung eingesetzt werden. Das geistige Eigentum löse das klassiche Urheber- und Patentrecht ab und schreibe die ungleichen Verhältnisse in den Handelsbeziehungen zwischen reichen und armen Ländern fest: Weiterlesen … »
Explosive Unterschiede
Die taz interviewt Kate Pickett von der Universität im englischen York zu einer Studie, die sie zusammen mit Richard Wilkinson schrieb. Diese versucht auf Grundlage sehr umfassenden statistischen Materials einen Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und gesellschaftlichen Problemen anhand diverser Indikatoren wie Kriminalität zu belegen. Im Vergleich der Daten aus zahlreichen Staaten wird erstmals der Beweis erbracht, daß Ungleichheit zu einer schlechteren Lebensqualität in Gesellschaften führe, die ebenso die Reichen und Priviligierten beträfe, meint die Autorin gegenüber der taz. Dies liege auch an dem Stress, den der Kampf um sozialen Status auslöse. Kritisch sieht eine Rezension von Wolfgang Kersting in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die irreführende deutsche Übersetzung des Titels.
Gewinner und Verlierer
Trotz des fortschreitenden Aufstands wurde es in den vergangenen Jahren in der Berichterstattung der Medien recht still um den Irak. Nun sind zu den Parlamentswahlen einige exzellente Dossiers erschienen. Die Wahlen seien durch eine neues Reglement in der Wahl der Kandidaten offener, jedoch habe eine »Gerechtigkeitskommission« nach fragwürdigen Kriterien 500 Kandidaten ausgeschlossen, so der Deutschlandfunk. Nir Rosen erkennt darin in der Le Monde diplomatique keine Bereitschaft zur Aussöhnung, denn die Schiiten hätten auf ganzer Linie gewonnen. Sie seien nicht bereit, die Macht zu teilen. Der amerikanische Journalist zählt in dieser kurzen Chronologie der jüngsten irakischen Geschichte die strategischen Fehler der Besatzungsmacht auf und verdeutlicht, wie diese den inneren Konflikt des Landes verschärften. Weiterlesen … »
Quo vadis, homo? Gaia oder Brandrodung?
Die Zerstörung der Umwelt durch Menschenhand wird nicht erst thematisiert, seitdem der Mensch Müll produziert, der tausend Jahre und länger braucht, um in den Kreislauf der Natur zurück zu finden oder die chemische Industrie Mittel herstellt, die für jeden Menschen, jedes Tier und jede Pflanze tödlich wären. In der Zeit schlägt Ulrich Grober auf hinreißende Weise einen Bogen von der kontroversen Behandlung des Themas durch den im 15. Jahrhundert lebenden Humanisten Paulus Niavis zum neuesten pop-kulturellen Werk, das sich damit auseinander setzt – »Avatar«. Dabei beschreibt er mit Liebe zu Niavis' lateinischem Originaltext, wie schon zu Zeiten des Raubbaus im sächsischen Erzgebirge die Frage aufkam, ob der Mensch das Recht hat, die Ressourcen der Natur bis zur Erschöpfung auszubeuten. Auch die - wie sich herausstellt - ganz und gar nicht neue Verwendung von Begriffen wie Nachhaltigkeit und Naturschutz macht er nachvollziehbar. So ist schon in dem Text von 1492 von lat. sustentare die Rede, was heute als engl. sustainability (Nachhaltigkeit) die Selbstdarstellung jedes Konzerns schmückt.
Hundert Jahre Verbrechen
Der Sender Phoenix strahlte 2008 die Dokumentation Schatten über dem Kongo aus, welche auf dem gleichnamigen Buch von Adam Hochschild basiert. Das Elend des aktuellen Bürgerkrieges und dessen Menschenrechtsverletzungen haben eine lange Geschichte, zurückgehend auf die Aneignung des Kongo durch den belgischen König Leopold II. Dieser erfand – recht diabolisch – eine philantropische Tarnung für sein Unternehmen, der Ausbeutung des Kongo. Bevor die Welt von diesem Verbrechen Notiz nahm, wurde die Bevölkerung nach Schätzungen um 10 Millionen Menschen auf die Hälfte dezimiert. Der Film widmet sich darüber hinaus der kolonialen und postkolonialen Ausbeutung des Landes. In diesem Zusammenhang ist der Film aus dem Jahre 2000 über den Tod von Patrice Lumumba erwähnenswert – Mord im Kolonialstil.
Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung läuft an
Die aktuelle Ausgabe der Jungle World liefert einen Themenschwerpunkt anläßlich des »europäischen Jahres 2010 gegen Armut und soziale Ausgrenzung«, das für Deutschland am Donnerstag in Berlin eröffnet wird.
Anton Landgraf vergleicht europäische Sozialpolitiken vor dem Hintergrund ihrer historischen Entwicklung. Deutlich wird dabei unter anderem, warum in Deutschland »die Grenze zwischen Armut, Sozialleistungen und Lohnarbeit« zusehends verschwimmt. Julian Bierwirth erklärt, wie die Bundesregierung den Betroffenen einer »staatliche[n] Verarmungspolitik« entsprechend »neuen Mut« und auch Beine machen will, denn ihr würden Weiterlesen … »