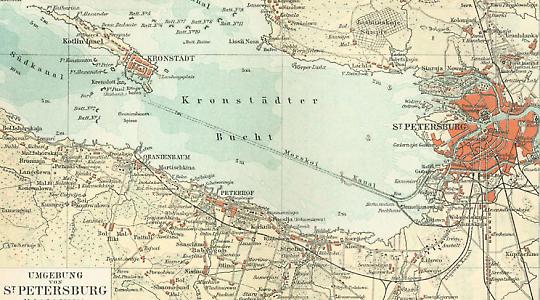Großer Sprung zurück
Der Umbau Ungarns zu einem autoritären Staat ist weit fortgeschritten, neue Gesetze schränken die Medienfreiheit und das Verfassungsgericht ein. Doch welche Konsequenzen hat das konkret? Spiegel Online stellt drei Menschen vor, die mit dem neuen Ungarn zu kämpfen haben: Eine Journalistin, die aufgrund ihrer kritischen Reportagen ihre Arbeit verlor. Eine Romafamilie in Gyöngyöspata, die trotz guter Ausbildung keine Arbeit findet und der Diskriminierung in der rechten Hochburg ausgeliefert ist. Eine Bürgerrechtlerin, die gegen die Ausgrenzung der Roma in den Schulen kämpft.
Gerade auf dem Land ist die Situation am rückständigsten: Da viele hier nur das Staatsfernsehen sehen, wirkt die Zensur in den Medien. Armut und Abgrenzung geben sich hier die Hand. Gyöngyöspata ist durch wochenlange Aufmärsche von Rechtsradikalen bekannt geworden, bei denen die Regierung nicht einschritt. Vielmehr setzt die Regierung Vorschläge der Jobbik-Partei um. Die dargestellte Situation erinnert an den Film Csak a szél (Nur der Wind), der auf der Berlinale den Großen Preis der Jury gewann und die alltägliche Diskriminierung der Roma thematisiert. Der Staatsumbau unter Victor Orban ist ebenso schleichend wie die alltägliche Diskriminierung nicht auf den ersten Blick sichtbar wird.
Dazwischengefunkt
Vielleicht ist es ja trotz anderslautender Bestimmungen im Grundgesetz nicht verwunderlich: Die Parteien versuchen erfolgreich, die einflussreichen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten unter Kontrolle zu bringen. Besonders über »ihre« Anhänger in den Verwaltungsräten. Dort wird über wichtige Fragen der Sender entschieden, nicht zuletzt auch über das Spitzenpersonal.
Seit dem spektakulären Fall Nikolaus Brenders beim ZDF ist es aber wieder stiller geworden um dieses Problem. Es besteht aber noch immer. Mittlerweile mischen auch die Grünen eifrig mit, obwohl sie lange die schärfsten Kritiker dieses Systems der Parteibuchkarrieren waren. Das könnte natürlich daran liegen, dass sie über ihre grün-rote Landesregierung in Stuttgart ebenfalls Zugriff auf die begehrten Posten bekommen haben.
»Minimalbeschreibung eines Bürgerrechtlers«
Joachim Gauck ist neuer Bundespräsident. Die urspünglich taktische Aufstellung des Pastors und späteren Verwalters der MfS-Akten durch die Oppostion 2010 hat sich durch das Votum der FDP 2012 verselbstständigt. Der Schritt ins Rampenlicht hat zugleich die Frage losgetreten, wie die Rolle Gaucks in der DDR zu bewerten ist. Zugleich steht er aufgrund von Äußerungen zur Einwanderung und der deutschen Vergangenheit in der Kritik. So greift Andreas Strippel die Bezeichnung Gaucks in vielen Medien als Bürgerrechtler oder gar als Freiheitskämpfer an. Dies sei nach den Aussagen damals Oppositioneller nicht richtig, denn er habe sich in der Friedensbewegung nicht eingebracht. Er sei zwar Gegner des »autoritären Polizeistaat[es] DDR« gewesen, dies mache ihn aber noch nicht zu einen Streiter für Freiheit. Vielmehr sei sein Freiheitsbegriff eindimensional und unscharf:
Weder ist Gauck ein Befürworter eines liberalen Individualismus, noch profiliert er sich als Kritiker autoritärer Tendenzen in der westlichen Demokratie.
Weiterlesen … »
Kind des Kalten Krieges
Wolfgang Gast richtet im Cicero sein Augenmerk auf den Verfassungsschutz; denn durch den Fall der aufgedeckten Mordserie steht die Frage im Raum, wie diese den Behörden entgehen konnte. Dem Autoren fällt wenig Schmeichelhaftes für den Dienst ein, der auf eine lange Pannenserie zurückblicken kann. Der Fehler liege in der Architektur:
Ihre Unfähigkeit, die Bedrohung von rechts genauso ernst zu nehmen wie die von links, erklärt sich aus der Geschichte der Dienste. Seit ihrer Gründung verstanden sich die geheimen Spionagejäger und Verfassungshüter als Soldaten des Kalten Krieges im geteilten Deutschland – und da saß der Feind eben links.
Besonders drängend sei dabei die Frage nach den V-Personen der Dienste. Diese haben das NPD-Verbotsverfahren verhindert und immer wieder die Grenze der Legalität weit überschritten. Die aktuelle Debatte durch die Untersuchungsausschüsse läßt Gast vorsichtig auf Reformen hoffen. Auch in den Diensten gab es Reformer, die aber kalt gestellt wurden. Die entscheidene kritische Erkenntnis des Autoren aber ist, daß der Verfassungsschutz ein Kind des Kalten Krieges ist.
Gefangen im Atomdorf
Schon ein ganzes Jahr muß sich Japan mit den Folgen eines Erdbebens herumplagen, welches das Vorstellungsvermögen in allen Prognosen sprengte. Johannes Hano beschäftigt sich im ZDF mit den Auswirkungen der Nuklearkatastrophe von Fukushima. Die Gefahren in dem Kraftwerkskomplex sind nicht gebannt, denn in den Abklingbecken des vierten Meilers lagern Brennstäbe, denen bei einem erneuten Beben der Einsturz droht. Die Folge wäre eine Kernschmelze unter freiem Himmel.
Der Bericht erscheint als Anklage gegen die japanische Atomlobby. Denn die systematische Schlamperei des Betreibers TEPCO wurde durch das »Atomdorf« gedeckt: einem Kartell aus Stromkonzernen, ihren Aufsehern, Wissenschaft und Politik. In Drehtürmanier werden Aufseher zu Managern und Manager zu Aufsehern, widersprüchliche Meinungen werden unterdrückt. Dieses Kartell ist laut dem ZDF-Report für die Katastrophe maßgeblich verantwortlich, denn die Risiken der Atomenergie durch Erdbeben wurden heruntergespielt. Hano spricht mit zahlreichen Experten – in einem ausführlichen Interview äußert der damalige Premier Naoto Kan schwere Vorwürfe gegen die Atomlobby. Weiterlesen … »
Wahlkampfrenner Millionärssteuer
Zumindest eines ist sicher: Hollande, Kandidat der französischen Sozialisten für die anstehenden Präsidentschaftswahlen, hat ein Gespür für Themen. Die Millionärssteuer dürfte darauf zurückzuführen sein. Angesichts klammer öffentlicher Kassen und immer noch bestehender Finanzspekulation ist die Idee ohne Zweifel populär. Franzosen mit mehr als einer Million Euro Jahreseinkommen sollen künftig 75 Prozent Einkommensteuer bezahlen. Wie so oft, steckt aber auch hier der Teufel im Detail. Denn tatsächlich betrifft das nur schätzungsweise 7.000 bis 30.000 Personen. Und selbst die könnten sich durch Abschreibungen arm rechnen, für ihr Einkommen unter dieser Schwelle würden sie ohnehin deutlich weniger zahlen. Der Umverteilungseffekt dürfte sich also sehr in Grenzen halten. Abgesehen davon liest sich Hollandes Programm sowieso nicht gerade revolutionär: Ein bisschen weniger sparen, eine Prise mehr Dezentralisierung - et voilà. Die von Sarkozy durchgesetzte Einbindung in die NATO beispielsweise soll dagegen beibehalten werden.
Byzantinische Ränkespiele in Rom
Wer hätte das gedacht: Die verfeindeten Fraktionen im Vatikan nutzen die Öffentlichkeit, um durch geleakte Papiere ihre Streitigkeiten auszutragen. So landete bei der italienischen Zeitung Il Fatto Quotidiano ein Papier vom 30.12.2011, in dem der sizilianische Kardinal vom sicheren Tod des Papstes in diesem Jahr munkelt: »Der Heilige Vater befasse sich im Geheimen mit der Frage seiner Nachfolge«, für die er den Mailänder Kardinal Angelo Scola vorgesehen habe. Zwar ist das Papier authentisch, doch der Inhalt mag zu einem Intrigenspiel gehören, das sich gegen den Sekretär des Papstes Tarcisio Bertone richtet. Souverän spürt Jörg Bremer für die FAZ den komplexen Machtverhältnissen im Kleinstaat Vatikan nach. Dazu bietet Stefan von Kempis vom Vatikanradio im Deutschlandfunk einige Grundlektionen der Welt rund um den Petersdom. Weiterlesen … »